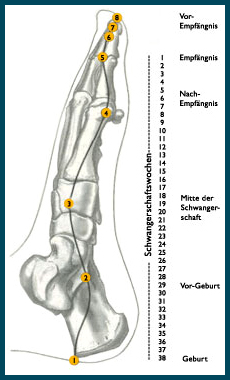Sizilien und seine Geschichte – das ist eine sehr wechselvolle Angelegenheit! Ich möchte im Nachfolgenden versuchen, Ihnen einen kleinen Überblick dazu zu verschaffen. Begleiten Sie mich also ein Stück zurück in die Vergangenheit…
Von der Frühgeschichte Siziliens weiß man, dass die ersten Einwohner der Insel Sikaner, Elymer, Aurunker und Sikuler waren. Diese Völker besiedelten vor allem die Küstenregionen und da wiederum vor allem die Bergkämme.
Dann wurde Sizilien von den Griechen „kolonialisiert“. Sie entdeckten für sich die fruchtbare Insel etwa im 8. Jh. v. Chr. und gründeten auch die ersten Städte, ebenfalls an der Küste. Die ursprünglich beheimateten Stämme fühlten sich wohl bedrängt, aber man nimmt an, dass sie sich im Laufe der Zeit mit den Griechen vermischten. Die ersten griechischen Städte in Sizilien waren Nasso, Syracusa, Lentini, Catania und Messina. Danach kamen Taormina, Agrigent, Gela, Segesta und andere mehr, nun auch schon weiter im Landesinneren.
Herrscher waren letztlich auch vielfach Tyrannen, denken wir nur an die Ballade „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller, wo es heißt: „Zu Dionys dem Tyrannen schlich Damon, den Dolch im Gewande…“ Und da findet man in Syracus das „Ohr des Dionys„, eine große Höhle mit nahezu unheimlicher Akkustik…
Gleich in der Nähe dieses „Ohrs“ befinden sich die Ausgrabungen des griechischen Theaters von Syracusa. Und – sozusagen „um’s Eck“ – findet man die Zeugen der Römerzeit, z.B. eine römische Arena. Der Unterschied: das griechische Theater bildet ein Halbrund, die römische Arena ein Oval.
Die Griechischen Bewohner Siziliens gaben der Insel den Namen „Trinakria“ (= drei Vorgebirge). Der Begriff lässt aber auch Rückschlüsse auf die Dreiecksform der Insel oder auf die drei verschiedenen Meere, die Sizilien umgeben, zu.
Es kam im Laufe der Zeit zu Konflikten mit dem antiken Karthago. Karthago ist an der Nordküste Afrikas angesiedelt. Die Karthager – ein kriegerisches Seefahrervolk – besetzten den Zipfel Siziliens an der Westküste. Syracusa und die Karthager lieferten sich heftige Gefechte. Diese gipfelten in den Punischen Kriegen, in denen die Römer bekannterweise die Karthager vernichteten. Daraufhin schwangen sich die Römer zu den Herrschern über Sizilien auf.
Man findet also auch viele römische Hinterlassenschaften auf der Insel, unter anderem einen wunderschönen Palast im Landesinneren, bei Piazza Amerina gelegen. In diesem Palast finden sich insgesamt 3500 m2 bunter Mosaiken (ja, ich hab mich nicht verschrieben, es sind wirklich so viele!), ein Bilderbuch aus der Zeit um ca. 300 n. Chr.
Nach den Römern kamen die Byzantiner. Aus dieser Zeit gibt es kaum bauliche Hinterlassenschaften. Danach – ab ca. dem 8. Jahrhundert – waren es die Araber, deren Einflüsse noch überall zu finden sind. Sie brachten nicht nur arabische Kunst nach Sizilien, sondern hatten auch Mandelbäume, Pistazien, Melonen, Zuckerrohr, Datteln und noch so manches andere „im Gepäck“, das heute den Zauber Siziliens unterstreicht. Die Maulbeerbäume bei Palermo beispielsweise dienten der Zucht von Seidenraupen und die Seidenmanufakturen von Palermo erlangten weitreichenden Ruhm. Unter arabischer Herrschaft wurden auch die Bodenschätze der Insel erschlossen und die ersten Salinen zur Gewinnung von Meersalz wurden errichtet. Palermo wurde durch die Araber zu einer der bedeutendsten Städte des Mittelmeers.
Im 11. Jahrhundert brach die Zeit der Normannen auf Sizilien an. Der erste Normannenkönig auf Sizilien, Roger I., war jedoch so klug, die Araber nicht völlig aus Sizilien zu vertreiben, er benutzte das Wissen des besiegten Volkes, um einen Teil seiner Beamten aus deren Reihen zu holen und den Großteil der Verwaltungsposten mit ihnen zu besetzen.
Es folgten eine Reihe von Königen aus dem Geschlecht von Roger I.: Roger II., Wilhelm I., Wilhelm II. Eine der Töchter von Roger II. heiratete den Staufer Heinrich VI. (deutscher Kaiser). Aus dieser Ehe entsprang Friedrich II., der bei den Sizilianern bis heute verehrt wird, nicht nur als ihr Herrscher, sondern auch als Astrologe, Dichter und Wissenschaftler. Friedrich II. wurde König von Sizilien und war auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er brachte Sizilien auch wirtschaftlichen Aufschwung.
Kaum war Friedrich II. verstorben, so wurde durch Papst Clemens IV. Karl von Anjou mit der Krone Siziliens belehnt. Dieser lebte jedoch nicht auf Sizilien, sondern in Neapel. Gegen die Herrschaft der Franzosen kam es im Jahr 1282 zum Volksaufstand, der als „Sizilianische Vesper“ in die Geschichtsbücher einging. Die Franzosen wurden vertrieben und es kam als nächster Herrscher Peter III. von Aragon nach Sizilien. Erst im 14. Jahrhundert kehrte letztlich Ruhe im Land ein (mit dem Frieden von Avignon).
In dieser Zeit entstanden viele der prächtigen Kirchen und trutzigen Burgen. Einen Teil davon haben wir uns angesehen und waren überwältigt von so viel Gold und unglaublichen Mosaiken.
Unter Kaiser Karl V. wurden auf Sizilien Küstenwachtürme und Befestigungsanlagen errichtet – man kann sie heute noch sehen. Er verlangte von Sizilien die Herausgabe der Gold- und Silberschätze, um damit seine Kriege quer durch Europa finanzieren zu können.
Lange Zeit wurde Sizilien dann durch Vizekönige regiert. Im 18. Jahrhundert fiel es dann nach den Spanischen Erbfolgekriegen an Savoyen und gleich danach an die Bourbonen. Im Barock wurde auf Sizilien viel gebaut. Einige der Städte waren durch Vulkanausbrüche und Erdbeben im 17. Jahrhundert zerstört worden. Nun wurden sie prächtiger als zuvor wieder aufgebaut. Die Bilder zeigen – der Reihe nach – Impressionen aus Noto, Catania und Syracusa.


 Es gibt noch viel zu erzählen über Sizilien. Aber darüber vielleicht ein anderes Mal. Hier noch ein paar Eindrücke:
Es gibt noch viel zu erzählen über Sizilien. Aber darüber vielleicht ein anderes Mal. Hier noch ein paar Eindrücke: